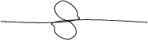
| zu den Gesamtinhaltsverzeichnissen |
| ^inh 2013031400 | monograph |
Wolfgang Hufschmidt zum neunundsiebzigsten Geburtstag,
denn Primzahlen soll man feiern.
Was ist "hufschmidtsch"?
Zunächst einmal ein Zungenbrecher, ähnlich "wie der Hirschschschreit".
Letzteres ist dennoch ein wirklich gelungenes Werk und beliebter Klassiker geworden. Also lassen wir uns nicht abschrecken und bleiben bei der etwas sperrigen Wortbildung!
Diese hat nämlich ihre tiefe Berechtigung darin, dass es im Werk, im Denken und in der Lehre von Wolfgang Hufschmidt Grundprinzipien gibt, die vermutlich nur sehr selten in dieser Strenge durchgehalten, in dieser Klarheit gelehrt und gleichzeitig zu solch vielfältiger Fruchtbarkeit gebracht werden.
Dankenswerterweise hat der Meister selbst in einigen Texten ([huf1] , [huf2] , [huf3] ) die Anwendung dieser Prinzipien deutlich demonstriert. Hier hingegen soll versucht werden, diese abstrakt und als solche explizit zu machen und kurz zusammenzufassen, wie der Verfasser sie als sein Student erlernen durfte.
Der Leser möge bitte beachten, dass folgender
Text einen durchaus subjektiven Blick bietet,
getrübt oder erweitert auch durch die Anwendung dieser Prinzipien
in des Verfassers eigenem Schaffen. Die folgenden Formulierungen mögen Mitstudenten,
auch Hufschmidt selbst, durchaus anders treffen, teils ihnen gar widersprechen.
Insbesondere die Begrifflichkeiten von "Hinter-, Mittel- und Vordergrund" sind
eigene Definitionen des Verfassers, die sich entwickelt haben durch
eine Verallgemeinerung ihres Gebrauches bei Heinrich Schenker auf das
kompositorische Denken gelernt bei Wolfgang Hufschmidt.
Angestrebt wird selbstverständlich, diese persönliche Einfärbung zu minimieren. Paradoxerweise kann aber gerade der subjektive Anteil für die thematische Frage "was ist hufschmidtsch?" sogar hilfreich sein. Der Verfasser durfte nämlich überrascht feststellen, dass jene Grundprinzipien, die es hier herauszuarbeiten gilt, in seinem eigenen Werke in ganz anderen stilistischen Zusammenhängen als den "Neue Musik"-Werken der Studienzeit hervortraten und formbestimmend wirkmächtig wurden, sich also weit über die Grenzen bestimmer Genres und Stile als sinnvoll und zweckmäßig erwiesen.
So werden sie ja auch von Hufschmidt selbst gelehrt, nämlich herauspräpariert aus dem Studium klassischer Werke. Die Grundprinzipien finden sich bei "guten Kompositionen" von Palestrina über die beiden Wiener Klassiken bis zu den Beatles prinzipiell stets gleich wirkmächtig und in gleich reiner Form.
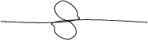
Nulltes Prinzip: Jede Komposition bestimmt sich aus ihrem Inneren:
Dieses Prinzip wurde im Unterricht nie eigens ausgesprochen, sondern immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Ist es aber nicht! Deshalb gelange es hier zur Ehre der Nummer Null in unserer Liste.
Es besagt, dass ganz im Gegensatz zu einer bei Laien vielfach anzutreffenden Meinung, eine musikalische Komposition nicht "entlang der Zeit" als "Abfolge von Effekten" und äußerlichen Phänomenen entsteht, erstellt wird und zu erleben und zu begreifen ist, sondern ihre Form hat durch ihre Hinter- und Mittelgrundgestalt, die sich im Vordergrund halt exprimiert, den zeitlichen Ablauf hervorbringt als Abwicklung ihrer an sich zeitlosen inneren Logik und Zwangsläufigkeit.
Die initialen Setzungen auf der Ebene von formaler und materialer Disposition bestimmen schon das, was sich "später dann" wie ein Film vor der Hörer abspielt. Je wertvoller das Werk, um so eindeutiger diese Determination.
(Z.B., die gewaltige Wirkung des Repriseneinsatzes im ersten Satz von Beethovens Neunter kommt eben nicht durch Instrumentationstricks und weil es wieder laut wird, sondern weil die leere Quinte schon der allerersten Takte danach schreit, ein Sextakkord zu werden.)
Dieses dem Fachmenschen so selbstverständlich scheinende Grundprinzip ist in der Tat auch in den meisten Kompositionslehren implizit vorausgesetzt, von frühem vokalem Kontrapunkt (die Menge der erlaubten "patterns", Normalfall vs. Ausnahme, erzeugt eine Gesamtstimmung), bis hin zur Zwölftontechnik (die innere Struktur der gewählten Reihe bestimmt die Möglichkeiten der Form).
Nichtsdestotrotz scheint es postmoderne Ideologien zu geben, die die subjektive Beliebigkeit in der Abfolge des Vordergrundes als ein Prinzip von Freiheit verkaufen wollen. Dem stehen Komponisten wie Hufschmidt mit Werk und Wort deutlich entgegen.
Minimalität der Setzung, Maximalität der Ableitung:
Bezeichnen wir mit Vordergrund die diachrone Gestalt der "fertigen" Komposition, mit Hintergrund die initialen Setzungen durch den Komponisten, und mit Mittelgrund alle Folgerungen und Ableitungen die zwischen diesen vermitteln, sei es im Laufe des Kompositionsprozesses, sei es im Vorgang des Rezipierens.
Dann gilt in der Lehre der Komposition nach Hufschmidt eine
sehr strikte Fassung des
principia non sunt multiplicanda praeter necessitatem:
Die initialen Setzungen im Hintergrund einer zu erstellenden Komposition
sollen minimal sein.
Diese Forderung hat nun in unterschiedlichen Zusammenhängen durchaus unterschiedliche Konsequenzen. Am einfachsten erklärt sie sich zunächst im Bereich abstrakten Materials: Wenn z.B. eine Folge von Tonklassen als Ausgangspunkt bestimmt ist, dann ist zunächst zu prüfen, ob sich (die ja daneben zum Erklingen auch noch notwendigen Rhythmen, Texte, Instrumentationsformeln, Großproportionen etc.) nicht daraus ableiten lassen, anstatt dass sie additiv ebenfalls initial frei gesetzt werden.
Dies gilt aber auch in allen anderen Kombinationsmöglichkeiten: Sei also z.B. ein Rhythmus (oder ein Text, oder eine Großform, ...) gegeben, so sollte ungekehrt die Folge der Tonhöhen möglichst aus diesen "data" abgeleitet werden, etc.
Die Forderung nach Minimalität des initialen Materials, oder nach Maximalität der gegenseitigen Ableitung, kann als Teil eines post-seriellen oder hyper-seriellen oder neo-seriellen Stils bezeichnet werden. Im Gegensatz zur klassischen Reihentechnik kann dabei (a) Material jedweder Art (Bühnenpositionen, Farben, geometrische Formen von Scheinwerferblenden, Gerüche, Gesten, Zeitungsschlagzeilen) Material einer "Skala" werden, auf der "Reihen" gespielt werden, die ihrerseits nun (b) durchaus (und meist zweckmäßigerweise !-) weniger als zwölf(12) Positionen umfassen dürfen, und (c) die jederzeit frei zwischen diesen so unterschiedlichen Sinnes-Skalen hin und her übertragen werden können, durch Re-Interpretation von Folgen ab-strakter Indizes.
Dieses neo-serielle Prinzip ist eine wichtige Grundlage Hufschmidtschen Denkens.
Gegen dies wird oft der Einwand vorgebracht, selbst von qualifizierter Seite, der Hörer könne derartige Organisationsformeln bei so disparatem Material "eh nicht nachvollziehen", dies sei Glasperlenspiel der Komponisten, die sich am Meta-Wissen berauschten, und ohne Relevanz für die Ästhetik des Endproduktes.
Dem halten wir entgegen: Diese Art der Ableitung mag in der Tat nicht immer bewußt nachvollziehbar sein, --- dies hängt von verschiedensten Faktoren ab, und ist auch nicht jedesmal tatsächlich intendiert. Immer jedoch induziert sie eine hohe Konsistenz des Materials, und damit Konsistenz der Vordergrundgestalt, die sich dem Hörer auch unterbewußt durchaus wirkmächtig mitteilt als "irgendwie schlüssig", und als gewollt.
Nicht nur bewußtes Hören ist Hören, nicht nur bewußtes Erleben ist Erkenntnis.
Das Prinzip minmaler Setzung und maximaler Ableitung gilt von den kleinsten Vorschlagsnoten-Folgen bis hinauf zur Gesamtform: In genau demselben Moment wo die Zahl sieben(7), die Zahl der Sätze des konventionellen Requiems, als Grundlage für Stephanus gewählt wurde, war klar, dass dieses Werk ein Quadrat werden müsse: sieben Sätze für sieben ausführenden Ensembles.
Minimale Ausdehnungen und maximale Selbstähnlichkeit:
Eine weitere, ebenfalls gut sichtbare Ausprägung des Minimalitätsprinzips
findet Anwendung auf das Material selbst, die Reihen und Formeln und
Indexfolgen: Diese können, ja sollten, wesentlich kürzer als
die klassischen zwölf Positionen sein.
Hufschmidts zugespitzte
Formulierung war oft "Man braucht nur die Zahlen zwei und drei."
In der Tat sieht man schon bei wichtigen Zwölftonreihen Anton Weberns, z.B. im Konzert op. 24 und Streichquartett op.28, dass sie aus den Transpositionen eines drei- oder viertönigen Kernes bestehen, also eigentlich in sich schon Abfolgen von "Dreitonreihen" (/"Viertonreihen") sind. Das aber ist ausreichend.
Dieselbe Technik wendet Hufschmidt an z.B. in den frühen Gleichnissen, 1962: die Reihe, in den vier Sätzen jeweils in einer der vier Grundgestalten auftretend, ist in sich eine Transposition eines dreitönigen "Generators".
Die initialen Setzungen sollen halt in allen Aspekten minimal sein,
auch rein quantitativ.
"Fang möglichst einfach an! Kompliziert wird's von alleine!" könnte man
all diese Prinzipien bis hierhin zusammenfassen.
All diese Regeln sind allerdings nicht als "unverbindliche freundliche Hinweise"
zu unterschätzen, sondern sind vielmehr (unmittelbar oder mittelbar)
stark materialgenerierend und
formbestimmend. Sie sind "harte" Regeln im Handwerk des Komponisten,
ähnlich wie früher die "korrekte Vorhaltsauflösung", nur auf einer sehr
viel allgemeineren, weiter sehenden Ebene der Gestaltung.
Konstant und variabel. Nullstellung:
Auch dies kann als Ausprägung des Minimalitätsprinzips verstanden werden: Bei jeder musikalischen Teilstruktur ist zu entscheiden, welche Parameter einem Prozess unterworfen werden (egal ob kreisend oder gerichtet oder zufällig oder motivisch oder ...) und welche anderen Parameter gleichzeitig dazu konstant bleiben (oder jedenfalls sehr viel einfacher gestaltet) und deshalb in den Hintergrund treten. "Nullstellen" nennt Hufschmidt das. Nur durch diese eindeutige Gewichtung ist es dem Hörer überhaupt möglich, einen Prozess als solchen zu erleben und evtl. auf einen bestimmten gemeinten Gehalt beziehen zu können.
Der Komponist muss den Mut haben, für bestimmte Zeiten bestimmte Parameter "nullzustellen", sie einfach liegenzulassen und eben nicht zu komponieren. Nur dadurch wird das Gemeinte als solches deutlich.
Lustigerweise kann man dieses Prinzip am deutlichsten erkennen bei einem Kollegen, den Hufschmidt nun garnicht mag, nämlich bei Richard Wagner: Ohne gehöriges Maß an Nullstellung wären dessen gewaltige Schinken niemals zu schreiben gewesen!
(Weiter unten werden wir noch weiteren Ausprägungen des Minimalitätsprinzips begegnen.)
Dialektik, der fruchtbare Widerspruch:
Auch innerhalb des Mittelgrundes, den auf die initialen Setzungen folgenden Ableitungsprozessen, ist Willkür verpönt: material- und formgenerierend wirke allein der Widerspruch und seine dialektische Aufhebung.
Also nicht der Kompromiss, der in der Kunst immer nur ein fauler sein kann, sondern (a) die Negation der Negation, (b) der Umschlag von Quantität in Qualität, oder (c) das Aufgehoben-Sein im dreifachen Sinne von Hoch-Heben, Beendigen und Fortdauern.
Die dialektischen Entwicklungsmöglichkeiten von Musik sind nicht ideologische
Schwärmerei, sondern konkrete Gestaltungskräfte. Demonstrabel schon deutlich im
immergleichen Bachschen Sequenzmodell:
Das Sequenzmotiv, als Thesis, wird eine Stufe höher wiederholt.
Dadurch verzerren sich aber die internen Größenverhältnisse der Intervalle, das
ist der Widerspruch, und
bei der zweiten Wiederholung, beim dritten Auftreten, bei der Synthese,
zerbirst das Modell schon in der Mitte, und Neues, Weiterführendes entsteht.
Immer geht das bei Bach so, hunderttausendfach, und ist es
einem jemals langweilig geworden?
Wann immer Bestimmungen aufeinanderstoßen, wenn Passagen die Grenze des Tonumfangs erreichen, wenn Rhythmen dichter als dicht werden, wenn zwei unvereinbare Aktionen gleichzeitig zusammenfallen, dann ist dialektische Lösung gefordert, dann kann, dann muss aus dem Widerspruch organisch und selbstverständlich das Neue hervorgehen, und der Hörer wird erstaunt feststellen: er hätte nichts anderes erwartet ...
Alles kann Material werden:
Derart generisch formulierte Prinzipien und Verfahren behaupten von sich, universell zu sein. Alles kann von ihnen gefressen und zum Gegenstande musikalischer Gestaltung gemacht werden: Zeitungsschlagzeilen ("Vater unser"), philosophische Systeme ("Das Prinzip Hoffnung"), Werkshallen-Geräusche ('Stephanus"), Statistiken ('Trio drei"), Bilder, Farben, Formen ("Weihnachtstriptychon", "Ruhrwerk").
Inwieweit dies ästhetisch sinnvoll oder gar "schön" ist, nachvollziehbar und adäquat, entscheidet sich je im Einzelfall, nicht zuletzt durch den Grad der handwerklichen Detailiertheit. Prinzipiell jedoch sind alle diese Medien und Materialien laut Hufschmidt höchlichst geeignet, (a) musikalisches Material zu werden und/oder umgekehrt, (b) mit kompositorischen Methoden verarbeitet zu werden.
Semantisierung durch Reduzierung/Dekonstruktion:
Ein besonders wichtiges Verfahren bei derartiger "Musikalisierung" genuin
nicht-musikalischer Materialien folgt wiederum dem Minimalitätsprinzip,
als es ein negatives ist: die weitgehende Dekonstruktion des Kontextes,
das Isolieren, das Heraus-Schneiden reicht oft schon, um aus einer realweltlichen
Klangprobe musikalisches Material zu machen, -- ja, es mit Semantik aufzuladen.
Und das bis zur Bedrohlichkeit.
Berühmtes Beispiel ist das "Besetzt-Zeichen" oder "Zeit-Signal" im
Stephanus.
Nicht vor der Soft Cell-Version von Tainted Love
wird ein solch simpler (Fast-)Sinus wieder dermaßen espressiv klingen dürfen!
Oder das einfache Durchzählen von "eins" ansteigend, im Minutenrhythmus,
im Watt, das in seiner einfachen Penetranz, im Kontrast zu all den
anderen gleichzeitig ablaufenden
und sehr komplexen Zahlenoperationen, geradezu zum Lachen zwingt,
verblüffenderweise.
Jede Komposition mache ihren Kontext explizit und beute ihn maximal aus:
Jedes heutzutage zu schaffendes Werk sei ein kritisches.
Immer muss es einen "Anlass" geben, der (allein durch ein bißchen Nachdenken) zum "zureichenden Grunde" werden muß. Damit wird jedes Werk ein notwendiges.
Hier findet sich nun eine weitere Ausprägung des
grundlegenden Minimalitäts-Prinzips:
Der "Anlass des Werkes" soll nämlich maximal exploriert werden,
um Material für die Komposition zu liefern. Dies nämlich minimiert
im Gegenzuge die Menge der zusätzlich notwendigen willkürlichen Setzungen.
Wenn ich z.B. ein "Streichquartett" schreiben will, dann muss,
so hat Verfasser es bei Hufschmidt gelernt,
in einer
Art "brain storming" all das, was im Begriffe schon, analytisch oder historisch,
enthalten ist, explizit gemacht werden, denn all dies ist schon Teil
meiner Entscheidung.
Dies sind so unterschiedliche Dinge wie die Zahlen "vier mal vier", wegen
der Saiten; die Zahlen "zwei gegen zwei", wegen der Instrumente;
die Zahlen "vier plus fünf", wegen der Tonhöhen der leeren Saiten;
die Beliebtheit von "Autoquartett" bei Grundschulkindern,
resp. heutzutage "Pokemons" ; die Buchstabenmenge
"dreimal Tee, einmal Err und Kuh, dazu A, E U"; die "Intervalle Quarte und Quinte";
das Spätwerk Beethovens; die Himmelsrichtungen; das
Partialtonspektrum über groß-C; andere Besetzungen gesehen als
Erweiterungen (Klavierquintett, Streichquintett, Oktett);
die "edelste Gattung der Kammermusik", von Schubert über
Bartok bis Lachenmann;
"Darm und Haar, Holz und Metall"; "Streichen, Klopfen, Reißen" ;
Dicta über und Theorie des Streichquartettes, die Idee des
"Gespräches", die Thesen von Mazzola;
die Menge der möglichen natürlichen und künstlichen Flageolet-Töne;
die gegenseitigen Resonanz-Möglichkeiten nach Helmholtz;
"Quartett" in der Literatur und Bühne, von Heiner Müller bis Loriot;
die Zahlenkonstruktionen "zwei hoch zwei", "zwei hoch vier", "vier hoch zwei";
...und so weiter, je nach Lust, Laune und Vorbildung, ...
Dies alles macht den kulturellen Kontext aus, in den ich mich
allein durch den Entschluss,
ein Streichquartett zu komponieren, bereits hineingestellt habe,
und den wir als "Hintergrund" jeder Komposition bezeichnen.
Das Ergebnis solcher Analyse werde nun
in den ersten Ableitungsschritten (die den "Mittelgrund" des Werkes eröffnen)
zum Materialgenerator, und es ist offensichtlich,
ein wie fruchtbarer: Aus obiger Liste könnte man
z.B. einfach das Tripel
"Streichen, Klopfen, Reißen" kombinieren mit der Tabelle der gleichen
und verschiedenen leeren Saiten, um die Klang-Disposition eines ganzen
Scherzo-Satzes fertig vorzufinden, etc.
Musik transportiert allemal Außer-Musikalisches, reflektiert allemal über "Musik":
Die Fülle der im vorigen Abschnitt entwickelten kulturellen Beziehungen, (noch bevor die erste Note geschrieben ist, und auch danach werden diese nicht weniger !-) besteht in einem großen Teil zu Gegebenheiten außerhalb der Musik. Dies zeigt, dass Außer-Musikalisches beim Erstellen und Erklingen von Musik allemal mit-transportiert wird, auf welche Weise, mit welcher Bewußtheit und in welcher Intensität auch immer.
Die Anbindung von Musik an Außer-Musikalisches ist also allemal
gegeben. Sie kann jedoch sehr unterschiedliche
Voraussetzungen und Konsequenzen haben, je nachdem ob dieses Außer-Musikalische
besteht in literarischen Texten, in Werken der bildenden Kunst, in
Fakten der Physik oder Physiologie, in historischer oder aktueller Politik,
--- oder wiederum in Musik.
Ja tatsächlich: Musik in ihrer historischen Rezeptionsgeschichte oder
ihren konkreten Produktionszwängen wäre aus der Sicht einer
romantisch konzipierten, "autark-sein-wollenden"
Komposition auch etwas durchaus Externes!
"Musik und Sprache", "Musik über Musik", so hießen deshalb wichtige Analyse-Seminare in Hufschmidts Lehrtätigkeit. Die Beispiele in seinem kompositorischen Werk sind ebenso zahlreich wie vielfältig, wie sich schon ergibt aus dem obenstehenden Abschnitt über die verschiedenen möglichen Materialien.
Hier etwas detailierter nur ein Beispiel, das den Verfasser sehr beeindruckte.
Dabei sind die außer-musikalischen Bezüge so unterschiedliches
wie der Mythos von "Kaspar Hauser" und die rein physikalischen und physiologischen
Gegebenheiten von Arm und Bogen und Geige und Nicht-Geiger.
Der Verfasser wird nie den magischen Moment des Warhnehmungsumschlages
vergessen im Solo für Gawriloff:
Der Protagonist nimmt die Geige, hat noch nie
eine gesehen; klopft sie ab;
probiert verschiedenste Kombinationen von Instrument, Bogen,
ihrem Körper und seinem Leib; erlernt langsam, wo es wie klingt;
erforscht Schritt für Schritt die physikalischen Gegebenheiten der vier gespannten
Saiten; wird immer geschickter, immer ruhiger;
streicht sie auf und ab und auf und ab und ---
Irgendwann
wunderte Verfasser sich schon über die kristalline Entschiedenheit der
inzwischen doch so leichten Aktionen, diese seltsame Anmutung von Logik,
und dann, unfassbar, kam es wie eine Offenbarung:
DAS IST JA Webern !!! WIE LANGE WOHL SCHON ???
1
Und ihm kamen die Tränen vor Glück.
Musik gründe sich auf Außer-Musikalisches!
Wenn schon Außer-Musikalisches allemal mit-transportiert wird,
da sollte das auch in möglichst bewußter Weise im Kompositionsprozeß
reflektiert werden.
Ja, mehr noch, die Grundlagen jeder Komposition dürfen nicht irgendwo
in einer vermeintlich freien, genialisch schweifenden inneren Anschauung
des autarken Urhebers liegen. Diese nämlich geht in die Falle,
genau diese Anbindungen des Materials, und damit Beschränkungen der
möglichen Rezeptionsweisen zu übersehen.
Vielmehr sollte die Anbindung an Konnotationen und Gegebenheiten möglichst
explizit erfolgen, durch bewußte Setzungen des Komponisten
in den frühesten Schritten der Ableitung.
Nehmen wir an, ein Gedicht sollte vertont werden, in dem Personen als
Protagonisten auftreten. Dann könnte es sinnvoll sein, die einzelnen Personen
(oder aber auch ihre Stimmungen, Haltungen, Konstellationen, etc.)
in musikalische Strukturen zu übersetzen.
Dies geschieht in der Weise einer Setzung oder Definition,
die besagt: In diesem Werk steht die musikalische Bestimmung x für das
zu übersetzende Urbild y.
Eine solche Festlegung nennt Hufschmidt "Metapher".
(Diese Bezeichnung ist wohl eher selbst eine "Metapher", aber als
Arbeitsbegriff so gut wie jeder andere ;-)
Es gibt dabei keine konkreten Regeln für konkrete Anwendungsfälle! Welche Art von Übersetzung vom Hörer nachvollziehbar, ästhetisch angemessen und formal tragfähig ist, oder eher dumm, geschmacklos und albern ("Es gingen zwei Jünger nach Emmaus ..."), kann nur im Einzelfall beurteilt werden.
Es gibt aber zwei allgemeine, harte Regeln, die allemal gelten:
Erstens: die abbildenden musikalischen Begriffe "x" sollten so einfach
wie möglich gewählt werden.
Also "Instrument Vla", oder "Lautstärke ff", oder "Intervall Quarte",
oder "Tonhöhe d", oder "Konsonant k", oder "rhythmische Punktierung", oder ...
Also keine "ausgreifenden Leitmotiv-Melodien", sondern primäres musikalisches Material.
Wenn die dadurch induzierten Festlegungen zu weit gingen,
also zu allgemein sind und zuviele Vordergrundabläufe unter sich begriffen,
können komplexer
zusammengesetzte Modelle zu "Metaphern" werden, wie bestimmte rhythmische
Formeln, Akkordformen oder Konsonantenfolgen.
Allemal aber sollte die innere Struktur der "x"
möglichst einfach bleiben. Sie sollen ja im folgenden der Komposition
(a) mit anderem kombinierbar sein, und dabei (b) vom Hörer auch (mehr oder
weniger bewußt) verfolgt werden können.
Eine parameterweise Disposition der Metaphern bietet sich also
allemal als bevorzugte Realisierungsmöglichkeit an.
Zweitens: Metaphern sind endgültig!
Wenn ein bestimmtes "x" in diesem Sinne festgelegt ist, dann behält dies
seine Bedeutung "y" für die gesamte Komposition!
Die Metaphersetzung muss eindeutig sein und bleiben.
Nachträgliche Um-Definitionen sind nicht erlaubt!
Sie würden nämlich schlichtweg nicht funktionieren.
Auch diese Regel kann als eine letzte
Variante des Minimalitätsprinzips angesehen werden.
Musik verhalte sich politisch!
Die Möglichkeit für Musik, außer-musikalische Inhalte zu transportieren,
impliziert, dass sie das allemal und immer auch tatsächlich tut!
Selbst wenn's der Komponist garnicht will!
Wenn dem aber so ist, dann impliziert das eine harte, unhintergehbare
Aufforderung an jeden sich kompositorisch Betätigenden.
Sich nämlich nicht politisch zu verhalten, wegzuschauen, zu ignorieren,
sich in den Elfenbeinturm zurückzuziehen, bedeutete dann
letztlich zuzustimmen.
"Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!"
Dieses Brecht-Zitat an die Nachgeborenen bringt es auf den Punkt, und ist zentraler Leitstern in Hufschmidts Werk und Unterricht.
Deshalb ist sein Werk nicht nur politisch, sondern stets auch parteilich, ausdrücklich auf der Seite der Opfer rechter Mordanschläge wie in Stephanus, auf der Seite ausgebeuteter Frauen, Trio drei, im Gedenken an die Opfer faschistischer Vernichtung, Jiddische Lieder, gegen die Hetzkampagnen der Springer-Presse, Vater Unser, oder auch als Verfechter und Verbreiter linker Gesellschaftskritik in grundsätzlicherem Bezug und weiteren Kontext, wie in Lied von der Tünche, We shall overcome,
Die einzigen Werke Hufschmidts, die dem Verfasser spontan
als "nicht-politisch" einfallen,
sind Spiele für Flöten und Es für Orgel.
(...aber selbst da
mag es ein dahinterliegendes ihm nicht bekanntes politisches Programm geben !-)
Tonalität ist nicht mehr benutzbar, aber re-konstruierbar:
Wie schon Max Weber in den "Grundlagen der Musik" [weberMusik] knapp und eindrucksvoll nachwies, reichen tatsächlich die kleinen ganzen Zahlen zwei und drei zur Konstruktion der gesamten westeuropäisch-traditionellen Tonalität, -- wie Hufschmidt dies im Unterricht für den viel weiteren Anwendungskreis von "Musik schlechthin" stets betonte.
Ist auch die "herkömmliche Tontalität" in ihrer naiven Verwendung zutiefst desavouiert, durch jüngst vergangene Geschichte und immer noch herrschende Gegenwart, durch benebelnden Faschismus und verdummenden Kommerz, kann aber dennoch derartige Zahlenlogik verwendet werden, um tonale Bezüge neu zu konstruieren, dank ihrer strengen Abgeleitetheit in wiedergewonnener (Fast-)Unschuld.
In Hufschmidts frühen Chorwerken finden wir konventionell-tonale Fugato-Sätze, die aber durch die Wahl der nicht-tonalen Sequenzmodelle bereits die Grenze naiver Verwendung deutlich übersteigen. So werden z.B. im Schlussteil von "Also hat Gott die Welt geliebt" die frei gesetzten Quarten der Einsatzabstände immer mehr verdichtet bis zur Folge von Quarten-Akkorden.
Geradezu komplementär dann dreißig Jahre später "We shall overcome": Die Logik der kleinen Zahlen zwei und drei gebiert hier Rhythmen und Klänge, wiederum im Chor, die gleichsam durch strengste serialistische Disposition hindurchgegangen sind und "am anderen Ende wieder herauskommend" den konventionellen Sound von Big-Band und Barbershop hervorbringen.
Tonalität ist also nicht mehr naiv benutzbar, aber als Ergebnis logischer Ableitungsprozesse allemal re-konstruierbar.
Die überwältigende Wirkung der getürmten Quinten am Ende des Meissener Tedeums steht in direktem Bezug und Kontrast zu den Quintenzirkel-Sequenzierungen am Schluss des Parsifal (wenngleich dies wahrscheinlich nicht intendiert ist, siehe oben !-): Beide funktionieren nur als Re-Konstruktion von tonalen Ordnungsstrukturen. Ohne deren vorherige Negation, als naive Anwendung, würden diese Stellen in Bedeutungslosigkeit implodieren. 2
So aber, wieder-geboren als logische Konsequenzen eines logischen Ableitungsprozesses, einmal hindurchgegangen durch das Chaos der gleichberechtigten Tonverteilung, gewinnen sie ihre ursprüngliche Strahlkraft und ihren Symbolgehalt zurück und dürfen affirmativ genossen werden, ohne dass der Stachel, gegen den das Werk gelöckt hat, vergessen werden braucht, oder gar darf.
Der Schluss dieser beiden gewaltigen Werke ist unmittelbar nachvollziehbare, mit Zwerchfell und Fußsohle erlebbare Dialektik.
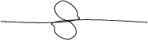
Die bis hierhin beschriebenen Prinzipien und genannten Kompositionen sollten einen Eindruck verschafft haben, wie sich im Werke Hufschmidts die konsistente Anwendung einfacher und klarer Grundprinzipien in Hinter- und Mittelgrund vereinbart mit einer Fülle der unterschiedlichsten Gestalten in der Vordergrundgestalt, also Besetzungen, Medien, Formen, Klanglichkeiten, Notationsmethoden, Freiheitsgraden, Stilen, Farben, ...
Wenn es auch in den letzten Jahren, im Vergleich zum "symphonischen" Höhepunkt von Stephanus und Meissener Tedeum die Tendenz zunehmender Verknappung und Versprödigung gibt (vielleicht notwendig für ein Spätwerk ?-), so meinen wir doch, dass der Meister sich in der Fülle seines Werkes kein einziges Mal unzulässig oder ermüdend wiederholt hat. Welch Phänomen!
Dies auch als Folge seiner intellektuellen Grund-Strategie, dass nämlich die unverzichtbaren Überzeugungen und Kompositionsprinzipien nicht auf der vordergründigen Ebene der Erscheinung definiert sind, sondern auf der sehr viel tiefer liegenden Ebene des Umganges mit den Erscheinungen, der Art der Materialanalyse und -synthese, der Zwangläufigkeit ihres Verbundenseins, und der Gewissenhaftigkeit aller Ableitungsvorgänge.
Dies führt zu größtmöglicher Buntheit in der Vordergrundstruktur seines Lebenswerkes, bei gleichzeitiger hoher Konsistenz und Konsequenz seines transzendentalen Gehaltes.
|
[huf1]
Struktur und Semantik. Texte zur Musik 1968 - 1988. Pfau, Saarbrücken, 1994 ISBN 3928654071 |
|
[huf2]
Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn? Zur Semantik der musikalischen Sprache in Schuberts Winterreise und Eislers Hollywood-Liederbuch. Pfau, Saarbrücken, 1997 ISBN 3-930735-68-7 |
|
[huf3]
Denken in Tönen Pfau, Saarbrücken, 2004 ISBN 3-89727-232-6 |
1 Vier Stücke für Violine und Klavier op.7
2 Siehe auch ../ston2010100200.html
©
senzatempo.de
markuslepper.eu
2025-08-13_13h57


produced with
eu.bandm.metatools.d2d
and XSLT
music typesetting by musixTeX
and LilyPond