
| zu den Gesamtinhaltsverzeichnissen | |
| 2016031100 | Déja audé |
| 2016031101 | Melodischer Topos: Adeste fideles |
| 2016031102 | Ein melodischer UND harmonischer Topos: diagonales Intervall |
| ^inh 2016031100 | phaenomen |
Vielleicht kennt auch der Leser dies Phänomen: Man hört ein Musikwerk
definitiv und nachweisbar das erste Mal, und es kommt einem unheimlich bekannt,
ja, vertraut vor.
So geschehen dem Verfasser vor (gefühlten) Jahrhunderten mit dem Scherzo aus
Bruckners Vierter Sinfonie.
Dafür gibt es nun verschiedenste Erklärungsmöglichkeiten:
Zunächst einmal ein "Déja audé" analog zu seinem "Déja vu".
Es liegt also gar keine Erinnerung vor, sondern einfach das anlasslose,
täuschende Gefühl einer Erinnerung.
Es kann aber auch sein, dass im Mutterleibe schon dieses Werk gehört worden war. Es also von "ganz Ferne aus der Kindheit scheint", also von dort, "worin noch niemand war, Heimath".
Es kann selbstverständlich auch sein, dass man, zwar nach der Geburt, aber vor sehr langem, das Werk einmal gehört hat, so nebenbei, vielleicht als Hintergundsmusik in einem Film, ohne es bewußt wahrzunehmen und abzuspeichern.
Es kann aber auch sein, dass die vielen Nachahmer, Auswerter und Verflacher das Werk dermaßen auslutschten, dass uns Spuren und Rudimente allüberall begegnen, und wir erschauern, wenn wir plötzlich dem Original begegnen, weil dieses sich, durch seine innere Kohärenz und Einfachheit, fraglos und mit frappierender Eindeutigkeit als solches zu erkennen gibt.
Wie dem auch sei, den Verfasser jedenfalls überfielen mit den ersten paar Takten genannten Werkes heilige Schauer, da er sofort fest wußte, dass es ihm angehört, dass es zu seinen frühesten Erinnerungen gehört. Aber nicht aus "dieser Welt".
| ^inh 2016031101 | phaenomen |
Ein an vielen wichtigen Stellen angetroffener melodischer Topos verbindet die Pendelbewegung zwischen Grundton und tieferem Dominantton mit einer Skalenbewegung von ersterem nach oben.
Eine relativ alte Version ist das Weihnachtslied Adeste Fideles, welches deshalb hier als Namensbezeichner herhalten muss. (Es stammt aus dem frühen 18ten Jahrhundert, Verfasser unbekannt.) Die Deutsche Textübersetzung beginnt meist mit "Herbei, o ihr Gläub’gen, singet Jubellieder", o.ä.)
Zeile Z0 zeigt die erwähnte Zweistimmigkeit zwischen dem Liegeton auf der (tiefgelegten) fünften Stufe und der Stufenbewegung in der Oberstimme.
Diese wird in Zeile Z1 in einer "internen Zweistimmigkeit" gebrochen, aber immer noch als deutlich konstitutiv empfunden.

Zeile Z2 zeigt den Anfang der Arietta des Cherubino (No.12 in der "Neuen Mozart-Ausgabe") aus dem zweiten Akt von Figaros Hochzeit / Le nozze di Figaro KV 492.
Zeile Z3 zeigt den Anfang des in Essen-Werden so gerne voller Inbrunst geschmetterten Ludgers-Liedes. Nähere Information dazu sind leider nicht bekannt, jedoch ist es für den Verfasser wichtig, weil es das hauptsächlich durchgeführte Schlussgruppenthema des Finales seiner Dritten Sinfonie darstellt.
Zeile Z4 zeigt den Anfang des Schlussgruppenthemas des ersten Satzes von Anton Bruckners Zweiter Sinfonie.
Zeile Z5 zeigt den Anfang eines beliebten "Elektro-Pop"-Schlagers aus den Achtzigern. (Leider noch keine weitere Info !?! FIXME Ultravox? )
| ^inh 2016031102 | phaenomen |
Als "diagonale Intervalle" könnte man Abfolgen zweier Klänge bezeichnen, in der ein melodischer Schritt und ein Harmoniewechsel zunächst unabhängig von einander gleichzeitig geschehen, und dann zu einem einzigen Phänomen zusammengefasst werden, z.B. durch Wiederholung, in dem sie zu Motiv oder Thema gerinnen.
Es wird also je ein "horizontales" und ein "vertikales" Gestaltungsmittel kombiniert.
Berühmtes Beispiel findet sich im Siegfried-Idyll, und es war dem Verfasser immer ein Rätsel, warum ihn diese Stelle so geheimnisvoll ergriff, bis er genau diesen Trick darin erkannte:

Das absteigende Intervall der kleinen Sexte springt in dieser Struktur immer in einen übermäßigen Dreiklang. Dies geschieht mehrfach, bei Takt 80, und kurz darauf (Wiederholung ist laut Schenker das einzige Mittel, ein "musikalisches Motiv" zu definieren!) bestätigend Takt 86. Dann gleich darauf, quasi durchführend, in einen anderen Kontext, ins piano, eine Oktave tiefer versetzt, T.102, aber sonst mitnichten transponiert!
Dann wieder mit originalem, ja gesteigertem Gestus in T.340 und T.346, in deutlicher
Reprisenfunktion.
Die letzten beiden Auftritte hat es in der Coda, dort
bei den Kadenzen nach T.384 und T.396 fortschreitende deutliche Reduktion: am Ende ist nur der
übermäßige Dreiklang als Gemeinsames übriggeblieten, und das Fallen eines springenden,
ansonsten beliebigen Intervalles, Quarte oder verminderte Septime.
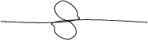
Der Effekt des "diagonalen Intervalles" ist nicht nur der einer herkömmlichen Harmonisierung, sondern das melodische Erleben wird in sich umgefärbt, wir hören das Intervall als Schritt zwischen verschiedenen Akkordfunktionen, und das klingt deutlich anders als dasselbe Intervall in einem neutralen Zusammenhang.
Am deutlichsten wird dieser Unterschied bei einem Intervall, welches keine eigene Charakteristik hat, welches (so wenig wie das weiße Licht als "Farbe") auch nicht als melodisches Intervall im engeren Sinne bezeichnet werden dürfte: der Oktave.
Mahler hat dies Problem im Finale seiner Sechsten Sinfonie: In beiden Ecksätzen ist die Oktave nicht nur ubiquitär, sondern auch themen- und stukturbildend. Die ersten beiden Töne das allerersten Themas sind die brutalstmöglich zuschlagende Oktave abwärts. (Man beachte aber auch die exzeptionelle Stelle T.144 des Andante in den ersten Violinen.)
Im Finale ist die Oktave präsent als allererstes Intervall des Einleitungs-Themas
Vl1 T.3 und der Aufbaufläche BTb T.16 (beidemale aufsteigend), und dann in der "choralartigen"
Fortsetzung der sog. Hauptthemengruppe. Diese wird in der einleitenden Steigerungsfläche
angedeutet und vorweggenommen schon ab T.42 in den Hrn, ab T.46 Trp und ab T.82 in den Fg,
um dann nach dem HTh ab T.141 im vollen Satz fröhliche Urständ zu feiern.
Dabei sind beide Bewegungsrichtungen vertreten, und das Intervall wird auch jedesmal sehr bald
zu Sexten bis Dezimen gestaucht oder erweitert.
(Die überraschend einsetzende, überschwänglich jubelnde Schlussgruppe ab T.205 beginnt auch mit der Oktave aufwärts, obwohl das im allgemeinen Gewühle wohl eher untergeht !-)
Hier im weiteren Verlaufe des Finales soll die Oktave dann endgültig zur Ehre des Motivs erhoben werden, und mit ihr die übliche komplexe satztechnische Arbeit durchgeführt werden: Engführungen, Imitationen, Augmentationen und Diminuitionen. Wie kann das gehen?
Dies zeigt der folgende Ausschnitt, ab T.728 = Zf.161. Er steht am Schluss der Durchführung und bildet von der Stimmung her einen der "positiven Abschnitte" (lt. Erin Ratz.) Hier findet kurz vor dem finalen Schicksalsschlag (dritter Hammerschlag am Rp-Beginn, T.783) eine schiere Verherrlichung der Oktaven statt. Genau dafür ist die Konstruktion von "diagonalen Intervallerlebnissen" das Mittel der Wahl: die hier erklingenden Oktaven sind nämlich nicht mehr "nackt", verbinden nicht einfach dieselbe Tonklasse in zwei verschiedenen Lagen, sondern verbinden zwei sehr verschiedene Funktions-Töne in zwei verschiedenen Funktions-Klängen. Es ändert sich also klar erkennbar mehr als nur die Oktavlage, und das ändert auch die emotionale Wirkung und Einfärbung des Intervalles, noch vor jeder bewußten Analyse:

Man merkt deutlich wie die jedesmal stattfindenden Wechsel der harmonischen Farbe zwischen den beiden Tönen des melodischen Ereignisses "Oktave", welches ja eigentlich ein Nicht-Ereignis ist, (a) überhaupt erst als interessant erlebbar machen, und wie sie (b) durch diese Nicht-Gleichheit der verschiedenen Oktavereignisse untereinander das Ersetzen am Schluss durch Sexte und None so stark vorbereiten, dass der tatsächliche mathematische Unterschied kaum noch spürbar ist.
Das Oktav-Fugato der Posaunen in der Coda, ab T.790, ist genau gegenteilig: nur
die zweite Oktave macht einen solchen Wechsel, alle anderen sind "redundant".
Am Ende siegt die graue Vergeblichkeit.
©
senzatempo.de
markuslepper.eu
2019-12-20_20h45


produced with
eu.bandm.metatools.d2d
and XSLT
music typesetting by musixTeX
and LilyPond